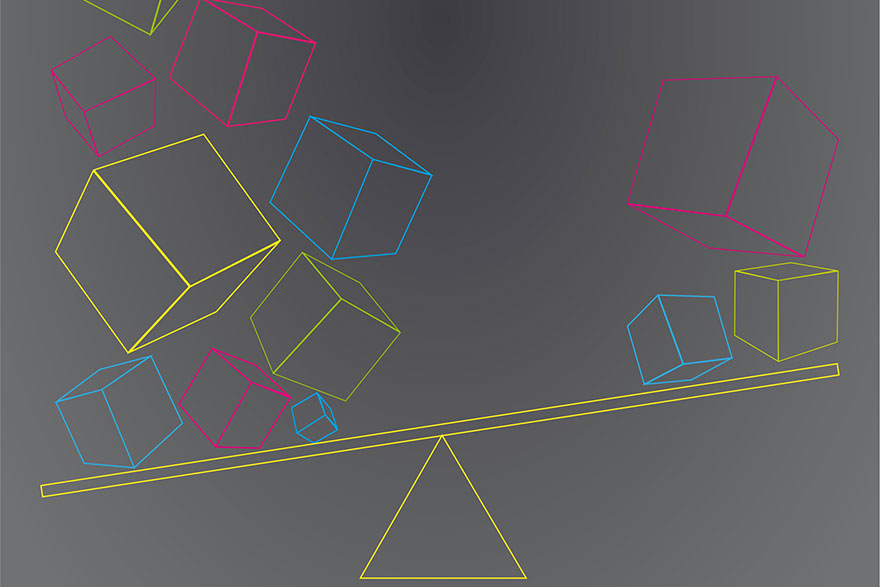Der Kapitalismus kann eine ziemlich anstrengende Sache sein. Doch muss man sich tatsächlich für den Job aufopfern, nur um sich gebraucht und produktiv zu fühlen? Es ist eine wahre Epidemie. Ob Wirtschaftsprüfer oder Automechaniker, Hausfrau oder Fußballprofi, Rechtsanwalt oder Sanitärinstallateur: Wenn in Deutschland über die Arbeit geredet wird, klingt es mitunter, als hätten die Menschen sich abgesprochen. Der Tenor jedenfalls ist fast immer der gleiche: Der Druck wächst. Die Überstunden nehmen überhand. Für Hobbies ist keine Zeit. Und die Familie? Die kommt sowieso immer zu kurz – wenn man überhaupt eine hat. Ein Volk ist im Stress Eine aktuelle Forsa-Umfrage im Auftrag der Techniker Krankenkasse belegt: Jeder vierte Deutsche leidet häufig oder ständig unter Stress und Erschöpfung. Bei den 46- bis 55-jährigen sind es sogar 36 Prozent. Nun könnte man sich auf den Standpunkt stellen, dass zwei Drittel der Menschen offenbar recht zufrieden mit ihrem Leben sind – und die anderen einfach ein bisschen kürzer treten sollten. Doch ganz so einfach liegen die Dinge nicht. Wenn ein erheblicher Teil der Bevölkerung eine zu hohe Arbeitsbelastung beklagt, ist das ein alarmierender Befund. Denn zu viel Arbeit macht nicht nur krank, sondern auf lange Sicht auch dumm. Das haben Forscher des Finnischen Instituts für Arbeitsmedizin in Helsinki herausgefunden. Im Rahmen der Langzeitstudie „Whitehall II“ untersuchten sie die Gesundheit von britischen Behördenmitarbeitern – und kamen zu einem erschreckenden Ergebnis. Angestellte, die dauerhaft mehr als 55 Stunden pro Woche arbeiteten, schnitten bei Tests ihres Kurzzeitgedächtnisses, beim logischen Denken und beim Sprachfluss deutlich schlechter ab als weniger belastete Kollegen. Zudem ergab die Studie: Bei zu vielen Überstunden steigt die Anfälligkeit für Herzkrankheiten. Und auch die Psyche leidet, wenn das Gleichgewicht zwischen Berufs- und Privatleben dauerhaft gestört ist. Wie viel Arbeit verträgt unser Leben? „Wer täglich zwischen Business Lunch und Babyschwimmen hin und her hetzt, wird im Zweifel keiner Aufgabe gerecht“, sagt Anabel Schröder vom Institut für Integrität, Werden und Wandel in Hamburg. Seit Jahren berät sie Arbeitnehmer und Unternehmen in Sachen Stressreduktion und Zeitmanagement. Ihre Erfahrung: „Wer dauerhaft sein Privatleben zugunsten der Arbeit vernachlässigt, leidet häufig unter Erschöpfung, Frust und dem Gefühl, nicht allen gerecht zu werden.“ Doch was ist der Grund, dass immer mehr Menschen ein Ungleichgewicht zwischen Arbeit und Privatem (oder neudeutsch: die fehlende „Work-Life-Balance“) beklagen? Ist unser Leben so viel anstrengender als früher – oder sehen wir Probleme, wo gar keine sind? „Beides“, sagt Beraterin Schröder. „Wer Montagmorgen um halb zehn schon inbrünstig das Wochenende herbeisehnt, macht sicher etwas falsch. Über einem Job, der einem keinerlei Zeit und Herzblut wert ist, würde jeder von uns verzweifeln.“ Nicht zu leugnen sei aber, dass sich die Arbeit in den vergangenen Jahren immer mehr verdichtet habe. „Der Trend zur Rationalisierung führt dazu, dass Unternehmen alle Stellschrauben nutzen, um die Effizienz zu steigern und Kosten zu senken“, so die Expertin. Dadurch verteile sich die vorhandene Arbeit automatisch auf weniger Schultern. Die ständige Erreichbarkeit über Smartphones und Tablets tue ein Übriges – vor allem bei Freiberuflern und Führungskräften. Der Feierabend hat ausgedient Eine aktuelle Studie des Beratungsunternehmens Mercer und der Technischen Universität München bestätigt diese These. Sie kommt zu dem Ergebnis: 86 Prozent der Führungskräfte in Deutschland fühlen sich durch die ständige Erreichbarkeit gestresst, nur zwei Prozent stehen Kollegen oder Geschäftspartnern nach Feierabend nicht mehr zur Verfügung und lesen auch keine arbeitsrelevanten E-Mails. „Eine solch kontinuierliche Vermischung von Privat- und Berufsleben ist ungesund“, warnt Beraterin Schröder. „Wenn nach Ablauf der regulären Bürozeiten auch die Freizeit noch mit Arbeit ausgefüllt ist, verkürzt sich die Regenerationszeit der Betroffenen.“ Welch dramatische Folgen das haben kann, belegt der Fall von Business Club-Mitglied Matthias Onken. Er wurde von seiner eigenen Karriere geradezu überrollt – und bemerkte lange Zeit gar nicht, wie leer die viele Arbeit sein Leben gemacht hatte. Dabei begann Onkens Geschichte wie ein modernes Märchen. Sein Berufsziel fasste er bereits im zarten Alter von zwölf Jahren. Er wollte Journalist werden. Mit bemerkenswerter Zielstrebigkeit arbeitete er daran, diesen Plan in die Tat umzusetzen, begann direkt nach dem Zivildienst ein Praktikum bei einer kleinen Lokalzeitung. „Ich war vom ersten Tag an gefesselt“, sagt Onken heute. Vor allem aber war er ausgesprochen erfolgreich. Gerade einmal zwölf Jahre nach seinem ersten Praktikum hatte er sich zum Chef der Hamburger Redaktion der Bild-Zeitung hochgearbeitet. Ein Aufstieg wie aus dem Bilderbuch. Doch Onken bemerkte nun, dass eine derart rasante Karriere nicht zum Nulltarif zu haben war. Ein Restleben außerhalb des Büros war in seiner Position nicht mehr möglich. Freundschaften zerbrachen, seine Ehe scheiterte, seinen Sohn sah er viel zu selten. Trotzdem machte er weiter. Dabei sei schon die Fahrt ins Büro purer Stress gewesen. E-Mails, SMS und Online- News auf dem Handy, die Nachrichten im Radio, die Zeitungen der Konkurrenz auf dem Beifahrersitz. „Ich fühlte mich wie ein Getriebener.“ Die Freude an der Arbeit hatte er längst verloren. Druck und die täglich Routine belasteten ihn von Tag zu Tag mehr. Hinzu kamen körperlichen Probleme: Magenschmerzen, Rückenleiden. Das Übliche eben. Bis Onken, mit gerade einmal 38 Jahren die Notbremse zog und kündigte. Seinen Ausstieg aus der Führungsposition hat er in einem Buch verarbeitet. Es ist eine schonungslose Abrechnung geworden. Mit dem System. Und mit dem eigenen Ehrgeiz. „Bis nichts mehr ging“, lautet der Titel. Beim Schreiben habe er sich kaum Gedanken darüber gemacht, wie die Reaktionen auf seine Lebensgeschichte ausfallen würden, erzählt Onken, der inzwischen als Medienberater arbeitet. Heute allerdings weiß er, dass er mit seiner Beichte einen Nerv getroffen hat. Er habe Dutzende Mails und Briefe mit verschiedensten Stressgeschichten erhalten. „Die Reaktionen, teils von sehr bekannten Führungspersönlichkeiten aus den verschiedensten Branchen, legen nahe, dass es in vielen Konzernen ähnlich aussieht“, erzählt Onken. Doch nicht nur in den Chefetagen scheint der Druck zu wachsen. Selbst die Aushilfe in seiner Reinigung habe ihn gleich angesprochen: „Das, was Sie haben, hab ich auch.“ Einfach mal abschalten Vor allem haben die Deutschen aber ein Organisationsproblem. Ihnen fehlt das Gefühl, neben der Arbeit noch Zeit zum Leben zu haben. Dabei ließe sich ein gewisser Zeitgewinn oft schon dadurch generieren, dass man nach Dienstschluss konsequent das Handy ausschaltet. Das beweist ein Projekt aus Braunschweig, bei dem Zehntklässler im April dieses Jahres für eine Woche ihre Smartphones weggeschlossen haben. Ähnlich wie so mancher Topmanager waren die Jugendlichen am Anfang des Versuchs ausgesprochen skeptisch, ob ein Leben „ohne“ überhaupt praktikabel sei. Am Ende der Woche allerdings waren sich die Teilnehmer einig: Durch den Verzicht haben sie bemerkenswert viel Zeit gewonnen, die Hausaufgaben waren schneller erledigt und es blieben mehr Freiräume für Sport und andere Dinge. Eine Erkenntnis, die auch dem einen oder anderen Workaholic helfen könnte. Doch in der Erwachsenenwelt braucht man offenbar noch ein wenig Zeit zum Umdenken. Kleine Einheit – großer Stress „Das Wissen, dass das Leben nicht nur aus Arbeit bestehen kann, ist inzwischen zwar weit verbreitet“, sagt Beraterin Schröder. Ein kleiner Handwerksbetrieb jedoch könne es sich meist nicht leisten, seine Mitarbeiter in Sabbaticals zu schicken, wenn die Auftragsbücher voll seien – und auch viele Selbstständige würden mit ihren Kräften nicht immer sinnvoll haushalten. „Wenn Arbeit da ist, wird eben geklotzt – egal, wie es einem geht.“ Hoffnungslos ist die Lage trotzdem nicht. Zumindest einige große Unternehmen scheinen begriffen zu haben, dass jede Leistung ihrer Mitarbeiter auch eine Gegenleistung nach sich ziehen muss – auch über das Gehalt hinaus. „Der oft zitierte Satz, dass die Mitarbeiter über Erfolg oder Misserfolg eines Unternehmens entscheiden, ist keine hohle Phrase“, weiß Schröder. „Und damit hängt der Erfolg eben auch davon ab, wie nachhaltig Firmen ihre Belegschaft unterstützen und fördern und inwieweit sie Rahmenbedingungen für ein gesundes Arbeiten schaffen.“ Wie das geht, machen die ersten Großkonzerne inzwischen vor. Der Chemieriese BASF zum Beispiel investiert derzeit in ein Zentrum für Work-Life-Management auf dem Werksgelände in Ludwigshafen. Andere Unternehmen – darunter auch die Telekom – versuchen, die Überflutung ihrer Mitarbeiter mit Arbeitsanfragen nach Feierabend zu begrenzen und reduzieren außerhalb der Bürozeiten den E-Mail-Empfang auf dem Diensthandy. Eine schöne Idee, der man nur wünschen kann, dass sie viele Nachahmer findet. Denn Arbeit ist zwar wichtig. Leben aber auch. Illustration: Jasmin Nesch Text: Catrin Gesellensetter Dr. Catrin Gesellensetter arbeitet als Wirtschaftsjournalistin in München. Die gelernte Juristin hat eine ausgeprägte Vorliebe für Karrierethemen und alles, was Recht ist. Sie schreibt unter anderem für Capital, das Handelsblatt und die Süddeutsche Zeitung.