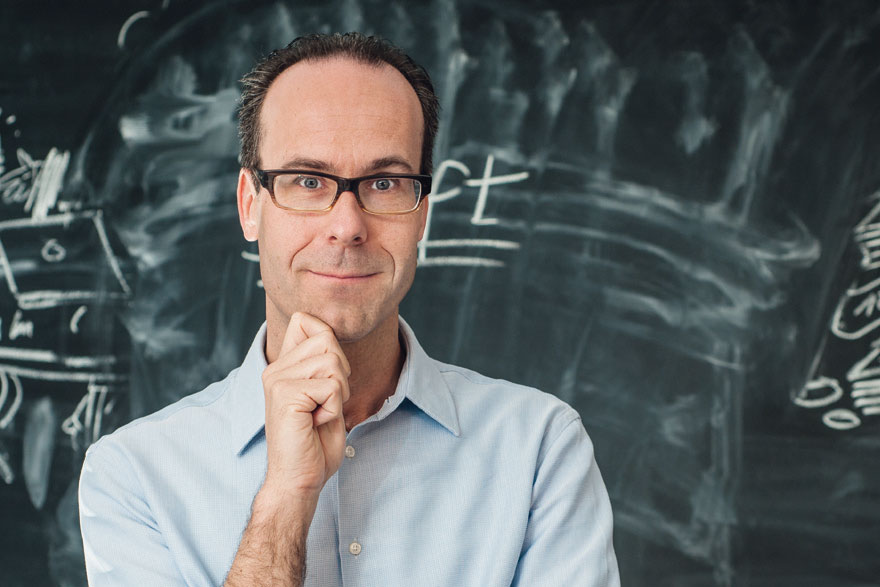Um erfolgreich Produkte auf den Markt zu bringen, reicht nicht nur eine kreative Idee. Das INNOVATIONSMANAGEMENT nutzt zur Vergrößerung des Innovationspotenzials auch Kräfte außerhalb des Unternehmens.
Bette Nesmith Graham ist genervt, seit ein paar Tagen steht diese neue elektrische Schreibmaschine in ihrem Büro, die ihr eigentlich die Arbeit erleichtern soll – aber stattdessen macht ihr die Maschine das Leben schwer: Die Tasten lassen sich jetzt viel schneller und leichter drücken, ständig vertippt sich Graham deshalb und die Fehler lassen sich nicht mehr wegradieren. Also muss sie jedes Mal ein neues Blatt Papier holen und wieder von vorne anfangen mit dem Text. Noch zu Hause ärgert sich die Sekretärin der Dallas’ „Texas Bank and Trust“ über das blöde Ding. Sie versucht sich abzulenken, malt ein paar Bilder, wie sie es gerne in ihrer Freizeit macht – und dabei kommt ihr der Gedanke, der sie reich und berühmt machen wird: Warum soll sie die Fehler nicht einfach übermalen können, so wie gerade ihre Leinwand? Graham mischt passend zum Papierton eine Farbe, pinselt sie über den Fehler – und die Idee für die Korrekturflüssigkeit, wie wir sie heute als Tipp-Ex kennen, ist geboren.
Mehr als 60 Jahre ist es jetzt her, dass Graham mit ihrer Erfindung namens „Mistake Out“ zur Millionärin wurde. Ihre Geschichte ist eines der besten Beispiele dafür, dass große Innovationen nur selten auf einen einzelnen Erfinder zurückgehen, der mit einem neuen Produkt eine Nachfrage schafft. Vielmehr ist es oft der frustrierte Nutzer selbst, der den Erfindergeist erst anregt – eine der zentralen Regeln, die jedes Unternehmen für sein Innovationsmanagement berücksichtigen sollte: Statt frustrierte Kunden als Belastung anzusehen, können diese als Innovationstreiber in den Entwicklungsprozess eingebunden werden.
Allerdings darf Innovationsmanagement nicht mit Kreativität verwechselt werden, also der reinen Entwicklung von Ideen – was nach Ansicht von Frank Piller, Professor für Technologie und Innovationsmanagement an der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule (RWTH) Aachen, noch immer zu häufig passiert. Die Innovationskultur eines Unternehmens werde am wirkungsvollsten zerstört durch „zu breite Ideenwettbewerbe“, sagt er.
In der Rangliste der innovativsten Länder liegt Deutschland auf Platz 6.
Viele Unternehmen würden möglichst viele Ideen generieren wollen. „Doch Innovation heißt, diese umzusetzen. Wenn ich als Unternehmensleitung nur Ideen forciere, den Mitarbeitern aber nicht zeige, dass ich diesen auch eine faire Umsetzungschance geben kann, führt das in vielen Kreativsessions nur zu Frustration.“ Und wer frustriert ist, entwickelt keine Ideen mehr oder verschweigt sie lieber.
Vielmehr meint der Begriff Innovationsmanagement also die systematische Planung, Steuerung und Kontrolle von Innovationen – ein Prozess, bei dem deutsche Unternehmen von anderen Ländern noch lernen können, wie der Global Competitiveness Report zeigt, den das Weltwirtschaftsforum Anfang Juli veröffentlicht hat. Im weltweiten Vergleich mit 144 Ländern liegt Deutschland – das sich in einer gemeinsamen Initiative von Bundesregierung und Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) als „Land der Ideen“ vermarktet – auf Platz sechs im Ranking der innovativsten Länder. Angeführt werden die Top Ten von Finnland, gefolgt von der Schweiz, Israel, Japan und den USA.
Um den Anschluss nicht zu verlieren, müssen deutsche Unternehmer ihr Innovationsmanagement besser organisieren. Gerade, weil Innovationen ein zentraler Erfolgsfaktor für Unternehmen sind, wie eine Studie der Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft PricewaterhouseCoopers (PwC) zeigt. Sie weist einen direkten Zusammenhang zwischen Innovationen und Wachstum nach: So ist die Gruppe der innovativsten Firmen in den letzten drei Jahren im Schnitt um fast 16 Prozent schneller gewachsen als die Gruppe derjenigen, die in der Studie als am wenigsten innovativ eingestuft werden. Zwar machen Unternehmen in Deutschland bei ihrem Innovationsmanagement bereits „sehr viel richtig“, stellt PwC-Experte Steffen Gackstatter fest. So hätten sie vielfach schon die nötigen strukturellen Voraussetzungen für erfolgreiche Innovationen geschaffen. „Allerdings konzentrieren sie sich noch zu stark auf Produktinnovationen und beziehen das Geschäftsmodell zu selten mit in die Innovationsüberlegungen ein“, kritisiert Gackstatter. Schwächen sieht er jedoch bei der Umsetzung in marktfertige Lösungen, problematisch sei auch, dass Unternehmen hierzulande im internationalen Vergleich weniger finanzielle Mittel für ihre Innovationsanstrengungen zur Verfügung stellen würden.
Wie aber wird aus einer Idee eine Innovation? Hier verweist der Aachener Innovationsforscher Piller auf zwei Wege: „Erstens ist da der systematische Prozess: Ein Unternehmen entdeckt ein Problem, entwickelt Ideen, verdichtet diese zu Konzepten, bewertet und testet die Konzepte im Markt, geht in die technologische Entwicklung, testet das Ergebnis nochmals und führt die neue Dienstleistung oder das neue Produkt ein.“ Hier bestehe aber stets die Gefahr, dass Produkte daran scheitern würden, dass sie am Markt vorbei entwickelt worden oder technisch noch nicht ausgereift seien. „80 Prozent aller Produkte, die im Supermarkt neu eingeführt werden, sind nach drei Monaten wieder weg, weil sich herausstellt, dass doch niemand das neue Joghurtgetränk mit Aloe Vera und Meersalz braucht“, sagt Piller. Zwar entspreche der erste Weg, der systematische Prozess, unserer gängigen Vorstellung von Innovation. Aber gerade in Zeiten des durch die Globalisierung wachsenden Wettbewerbs- und damit auch Innovationsdrucks gewinne der zweite Weg deutlich an Bedeutung: „Hier steht der Nutzer im Vordergrund, der sich über etwas ärgert und selbst erfinderisch tätig wird.“ So wie beispielsweise Tipp-Ex-Erfinderin Graham.
Open Innovation wird diese Öffnung des Innovationsprozesses genannt, bei dem auch Kräfte außerhalb des Unternehmens genutzt werden, um das Innovationspotenzial zu vergrößern. In Abgrenzung von klassischer Auftragsforschung, wie sie in den Forschungs- und Entwicklungsabteilungen stattfinde, gehe es darum, mit Hilfe neuer Plattformen deutliche Effizienzsteigerungen durch „nicht-offensichtliche Andere“ zu fi nden. Das seien aber nicht unbedingt Kunden, „denn die sind ja offensichtlich zufrieden mit dem, was ich als Unternehmer bereits mache“, erläutert Piller. Höchstens würden sie das Produkt billiger oder besser haben wollen. Interessanter für Open Innovation seien deshalb frustrierte Nutzer, zu finden beispielsweise in Internet-Communities. Beispielsweise habe der Hamburger Konzern Beiersdorf über diesen Weg eine der erfolgreichsten Produkteinführungen in der Unternehmensgeschichte umsetzen können: Nivea Invisible, ein Deostift, der keine Flecken auf weißer Kleidung verursacht.
Ausgangsbasis dafür ist nach Angaben von Piller eine Recherche in Internet-Foren gewesen: „Worüber reden Leute, wenn sie sich über Deos unterhalten?“ Es gebe mehr als 80 Foren und Communities von Kunden für Kunden, in denen Leute über Deos reden. Die klassischen Entwicklungsprioritäten bei Deo seien bis dahin „hautverträglich“, „schweißhemmend“, „preiswert“ und „gut riechend“ gewesen. „In den Communities aber waren Deoflecken in der Kleidung ein ganz zentrales Thema. Natürlich wusste man auch bei Beiersdorf, dass Deos Flecken verursachen – hat das aber eher als Problem von Waschmittelherstellern gesehen.“ Im Internet aber habe es ein ganzes Repertoire an Rezepturen frustrierter Nutzer für selbstgebastelte Deos ohne Flecken gegeben. „Mit dieser Erkenntnis bekam das Thema höhere Priorität. Für die Lösung brauchte Beiersdorf aber auch Textilkompetenz. In einem klassischen Open-Innovation- Prozess mit einem Textilforschungsinstitut wurde in einem Wettbewerb nach Ingredienzien gesucht, mit denen die Inhaltsstoffe, die für die Flecken verantwortlich waren, ersetzt werden konnten.“
Das eigentliche Problem beim Open-Innovation-Prozess aber sei die Umsetzung. Während Kooperationen bei großen Unternehmen eher genutzt würden, scheitere der Mittelstand am deutschen Ingenieursstolz. „Das ,not invented here’ ist ein klassisches Kulturphänomen, eine der großen Hürden im Innovationsmanagement und gerade bei deutschen, erfolgreichen, ingenieursgetriebenen Mittelständlern sehr ausgeprägt“, betont Piller. „Da muss man entweder sehr viel Kulturarbeit leisten oder Open Innovation zur Chefsache machen.“ Sonst befürchte der Ingenieur, dass er als unfähig dastehe – weil er ja nicht auf die Lösung gekommen sei.
„Das ‚not invented here’ ist eine der großen Hürden im Innovationsmanagement.“ Professor Frank Piller von der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule Aachen
„Wir geben schließlich unseren Ingenieuren in der Ausbildung auf den Weg: Ihr seid die Besten und kein Problem ist für euch zu schwer – statt ihnen auch beizubringen, erst mal zu schauen, ob es nicht schon eine Lösung gibt – bevor sie selbst anfangen zu lösen.“ Auch Nils Müller, Gründer und Geschäftsführer der Hamburger Agentur Trendone, rät Unternehmern, „ein bisschen weniger verklemmt“ zu sein. Aus Sorge um die Wahrung des Wirtschaftsgeheimnisses werde der Open-Innovation-Prozess noch zu wenig genutzt. Als Ergänzung zu Piller verweist er auf die Möglichkeit, dass ein Unternehmen auch einen Inkubator betreiben könne, also ein Gründerzentrum, in dem innovative Neugründungen entwickelt werden, die dem Mutterkonzern helfen, bestehende Geschäftsfelder weiterzuentwickeln oder neue Geschäftsfelder zu erschließen. Gerade in Kooperation mit der Start-up-Szene wird dieses „Brutkasten“-System gerne genutzt.
So ist die in Hamburg ansässige Otto Group mit „e.ventures“ und „Project A“ als Risikokapitalgeber aktiv und aktuell an über 100 Start-ups auf drei Kontinenten beteiligt, wie Lars Finger, Direktor des E-Commerce Competence Center der Otto Group, erklärt: „Dabei handelt es sich aber nicht nur um reine Finanzinvestments, sondern auch um den Aufbau von Kompetenzen, um den Konzern zu transformieren. Das gelingt unter anderem über den Erfahrungsaustausch mit den Start-ups. Dienstleistungen, die die Portfolio-Unternehmen anbieten, können zudem von der Otto Group genutzt werden, beispielsweise im Bereich In-Store-Analytics.“ Dazu sei kürzlich der erste interne „Hackathon“ durchgeführt worden, durch den neue Ideen hervorgebracht worden seien, die dem Konzern nachhaltig weiterhelfen würden, um sich als Handelsunternehmen im digitalen Zeitalter weiterzuentwickeln.
Wie wichtig es ist, bei solchen Ideenentwicklungen auch auf die eigenen Angestellten zu hören, hat Bette Nesmith Graham gezeigt. Vielleicht kommt die nächste millionenschwere Idee nicht vom unternehmenseigenen Innovationsmanager – sondern von der Sekretärin.
Text: Sonja Àlvarez Illustration: Raphaela Schröder
Sonja Álvarez schreibt für den Tagesspiegel in Berlin und das Handelsblatt in Düsseldorf – dank moderner Kommunikationstechnik ist der Standort der Redaktion aber kaum von Bedeutung.