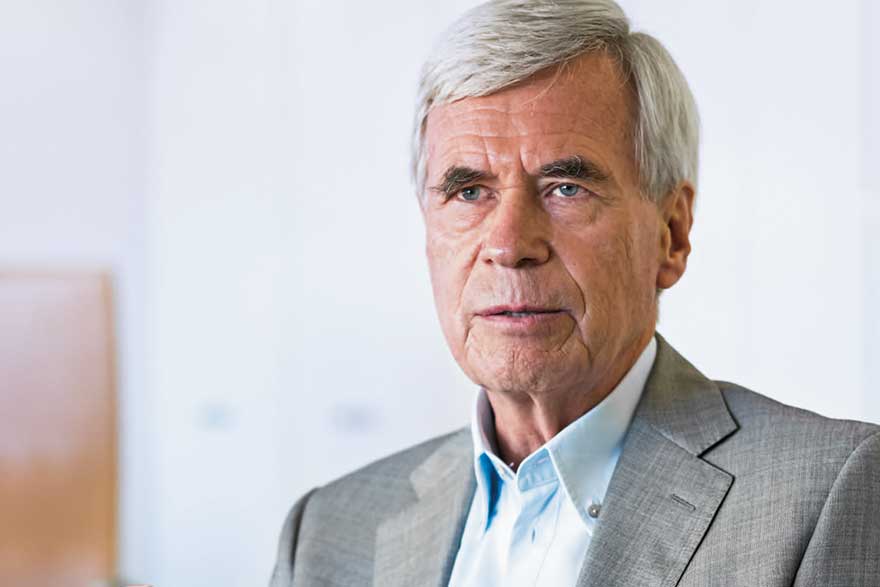Mit 38 Jahren übernahm Dr. Michael Otto das Unternehmen seines Vaters Werner und entwickelte es zu einem Global Player. In club! spricht er über Digitalisierung im Handel, fehlenden Mut von Existenzgründern in Deutschland und ein mögliches Unternehmer-Gen.
Herr Dr. Otto, unter Hanseaten wurde ein Geschäft früher per Handschlag abgeschlossen. Heute machen die Menschen nur noch einen Klick und schon ist der Deal perfekt. Wie finden Sie das?
Michael Otto: Das ist einfach die technische Weiterentwicklung, und die finde ich gut. Wichtig ist doch, dass man Vertrauen zu seinem Vertragspartner hat oder die Kundinnen und Kunden zum Unternehmen. Vertrauen ist die Basis des Erfolgs.
Ist es durch die Anonymität nicht schwierig, vertrauensvoll zusammenzuarbeiten?
Dann gäbe es uns als Onlinehändler ja gar nicht. Als unser Unternehmen gegründet wurde, kannte man die ersten Kunden sogar noch ganz persönlich. Aber das hat natürlich schnell aufgehört. Wobei es auch heute noch ein Teil unseres Erfolgsmodells ist, dass unsere Kundinnen und Kunden uns persönlich erreichen können. Und es gibt vereinzelte Kundinnen aus früherer Zeit, die mir zu Weihnachten schreiben und denen ich auch antworte.
Sie haben die Otto Group Mitte der 90er Jahre auf Kurs Richtung Internet gebracht. Inzwischen ist das Unternehmen einer der größten Onlinehändler der Welt. Hatten Sie eine Vision oder einfach das richtige Näschen?
Ich bin seit Anfang der 80er Jahre alle zwei Jahre mit meinem IT-Vorstand in die USA gefahren. Heute ist es ja modern geworden, ins Silicon Valley zu fahren. Aber damals habe ich dort kaum einen Europäer getroffen. Wir haben auch an der Ostküste große Hard- und Softwareunternehmen und Start-ups besucht. Als Ende der 80er das interaktive Fernsehen aufkam, habe ich mir gedacht: Das ist die moderne Form des Versandhandels. Wenn die berufstätige Frau nach Hause kommt, kann sie sich zu jeder Zeit anschauen, was es an schicken Kleidern gibt. Dann kann sie sich eins aussuchen, bestellen und am nächsten Tag wird es geliefert. Deshalb haben wir bereits zu Beginn der 90er Jahre einen Test zusammen mit Time Warner in Orlando begonnen. Die waren an Video on Demand interessiert. Als das Internet für die Allgemeinheit zugänglich wurde, haben wir sofort entschieden: Wir gehen ins Internet. Der Test wurde gestoppt, und ab 1995 wurde unser Sortiment im Internet angeboten.
Gab es bei Ihren Besuchen in Amerika Begebenheiten, bei denen Sie dachten: Das ist die Zukunft?
Ich erinnere mich an ein Start-up, das nannte sich „Thinking Machines“. Damals hatten große Computer einen Mainframe und einen ganz starken Rechner, eventuell zwei. Die Thinking Machines hatten Hunderte von kleineren Prozessoren. Für damalige Verhältnisse waren die unwahrscheinlich schnell. Die Firma arbeitete unter anderem für die US-Marine. Mit Hilfe ihrer Bilderkennung konnten sie feindliche und befreundete Schiffe unterscheiden. Das Thema Bilderkennung fand ich spannend. Wir haben circa vier Wochen später bei der Firma angefragt, ob wir zusammen arbeiten wollen. Die Dame am Telefon antwortete: Tut uns leid, wir sind gerade vom Militär übernommen worden und dürfen nur noch für die arbeiten.
Was macht das Silicon Valley anders als andere IT-Zentren?
Ich glaube, das Silicon Valley hat den Vorteil, dass sich zum einen durch die Universitäten viele junge Leute selbstständig machen. Zum anderen, dass dort auch viel Kapital bereitgestellt wird. Es besteht dort ein hohes Interesse, junge Gründer mit Kapital auszustatten, wenn sie gute Ideen haben. Es ist auch überhaupt kein Problem, wenn sie scheitern. Die Fehlerkultur ist in Amerika ganz anders ausgeprägt als bei uns. Deshalb beschäftigen wir uns mit diesem Thema auch in der Otto Group. Wir haben vor zwei, drei Jahren festgestellt, dass das Tempo bei der Digitalisierung deutlich zugenommen hat. Deswegen haben wir das Projekt „Kulturwandel 4.0“ ins Leben gerufen, um auch bei uns noch einmal Fahrt aufzunehmen und agiler zu werden. Wir haben erkannt, dass auch wir eine andere Fehlerkultur etablieren müssen. Wenn wir ein Konzept entwickeln, müssen wir keine 120-prozentige Sicherheit haben, um starten zu können. Wir können auch mal mit 70 oder 80 Prozent loslegen. Anfangen, Fehler machen, schnell korrigieren. Das ist eine ganz andere Offenheit, mit Fehlern umzugehen. Heute versuchen auch wir, unsere Mitarbeiter immer wieder dahingehend zu ermutigen, einfach mal Dinge zu machen, eigenverantwortlich zu handeln und Fehler zu riskieren. Dazu haben wir die sogenannten „Fuck-up nights“ ins Leben gerufen. Das klingt gefährlicher, als es ist. Es sind Veranstaltungen, bei denen vor allem Führungskräfte aber auch andere Mitarbeiter bereit sind, offen zu sagen: Den Fehler habe ich gemacht, das habe ich daraus gelernt. Es geht um die Offenheit, sich zu Fehlern zu bekennen, nicht darüber nicht zu sprechen oder sie gar zu vertuschen.
Sehen Sie ein „Next big Thing“ im Onlinehandel?
Da gibt es einige Entwicklungen. Zum Beispiel Voice Recognition, also die Kommunikation durch Sprache. Anfragen, ob bestimmte Artikel lieferbar sind, Anfragen, wo sich die bestellte Sendung gerade befindet, aber auch Eingabe von Aufträgen. Die Bildung von Angebotsplattformen ist ebenfalls ein zukünftiges Thema. Die Einzelgesellschaft OTTO entwickelt sich zu einer Plattform im Bereich Möbel und Living, auf der wir auch Wettbewerber aufnehmen. Dann haben wir eine Suchfunktion für Möbel, bei der auch andere Möbelhäuser wie beispielsweise Ikea dabei sind. Wenn jemand ein Möbelstück sucht und auf diese Suchfunktion geht, findet er es mit hoher Wahrscheinlichkeit oder er findet zumindest etwas, was sehr ähnlich ist. Ein weiteres Thema ist Augmented Reality. Wir bieten eine App an, mit der man zum Beispiel sein Zimmer auf dem Smartphone anschauen und Möbel aus unserem Sortiment in den Raum stellen kann. Sie werden sofort proportionsgerecht eingegeben, so dass man sagen kann, ob der Sessel oder das Sofa vom Platz, Design und farblich ins Zimmer passt. Und wenn alles okay ist, kann man direkt die Bestellung aufgeben. Das wird sich auch in andere Bereiche fortsetzen.
Was bedeutet das für den stationären Handel? Werden Geschäfte irgendwann überflüssig?
Nein. Ich glaube sogar, dass der stationäre Einzelhandel in Verbindung mit dem Internet ein wichtiger Teil der Zukunft ist. Aber nur, wenn Geschäft und Online richtig miteinander vernetzt sind und nicht als getrennte Kanäle betrieben werden. Wir haben beispielsweise bei SportScheck ein entsprechendes System. Ein Beispiel: Der Kunde sieht im Onlineshop eine Outdoorjacke. Sie gefällt ihm, und er würde sie gern anprobieren. Er bekommt die Information, wo der nächste Store ist, und kann die Jacke dort reservieren lassen. Dann kann er hingehen, sie anprobieren und bei Gefallen kaufen. Oder umgekehrt: Wenn man die Jacke im Store sieht, sie aber nicht in der richtigen Farbe vorhanden ist, kann die Verkäuferin auf einem Display sehen, in welchen Farben die Jacke im Lager ist. Der Kunde kann sie bestellen und im Laden abholen oder sie wird zu ihm nach Hause geschickt. Da sehe ich die Zukunft.
Viele Händler beklagen, dass Kunden sich im Ladengeschäft beraten lassen und am Ende im Internet die Produkte bestellen, weil sie dort günstiger sind.
Das stimmt, aber das gibt es auch umgekehrt. Leute schauen sich online etwas an und gehen ins Geschäft, um es zu kaufen. Das Problem ist, dass ein großer Teil des Einzelhandels online nicht vernünftig aufgestellt ist. Viele sind gar nicht online, andere haben eine laienhafte Homepage ohne Anbindung an die Sortimentsverfügbarkeit. Die Einzelhändler müssen viel mehr die Chancen erkennen, die sich ihnen mit dem Onlinehandel bieten.
Wie kaufen Sie eigentlich ein?
Online. Einmal im Jahr gehe ich auch in die Stadt, um mir einen Anzug oder etwas Spezielles zu kaufen. Aber normalerweise mache ich alles online. Ich bin insofern ein moderner Einkaufsmuffel.
Sie kamen mit 28 Jahren in den Vorstand, zehn Jahre später übernahmen Sie die Geschäftsführung des Unternehmens. War Ihnen immer klar, dass Sie die Firma Ihres Vaters irgendwann leiten würden?
Ich habe schon als Schüler im Unternehmen gejobbt und bin sozusagen mit dem Unternehmen groß geworden. Mein Vater hat gesagt: Du wirst das Unternehmen später übernehmen. Aber nach dem Abitur habe ich mir Gedanken gemacht, ob es der richtige Weg für mich ist. Eine ernsthafte Alternative wäre für mich auch das Medizinstudium gewesen. Aber dann habe ich mich doch für das Unternehmen entschieden. Ich finde, das Spannende am Unternehmerberuf ist, dass beide Gehirnhälften gefordert sind. Zum einen das Kreative, denn es gehört Fantasie dazu, ein Unternehmen aufzubauen und zu entwickeln. Zum anderen das Analytische, das Zahlenmäßige, das notwendig ist. Ich habe es zeit meines Lebens nicht bereut, diesen Weg gegangen zu sein.
Gibt es eigentlich so etwas wie ein Unternehmer-Gen?
Ich könnte es mir vorstellen, weil es meinem Sohn auch so ging. Er hat schon während der Schulzeit auf Wochenmärkten gehandelt und Sachen verkauft, und er hat sich vor 15 Jahren nach seinem Studium in Berlin sofort selbstständig gemacht. Mit einem sehr innovativen Thema: Intelligent House Solution. Das Smart Home war zu der Zeit noch gar kein Thema. Er hat ein erfolgreiches Unternehmen aufgebaut, das nach wie vor existiert. Und er hat das Tochterunternehmen About you mit aufgebaut. Da kann man schon vermuten, dass es vielleicht eine genetische Vorbestimmung gibt. Aber es gibt natürlich auch genügend gegenteilige Beispiele.
Was steht denn auf der DNA des Unternehmer-Gens drauf?
Mut, Optimismus und Durchhaltevermögen stehen darauf. Man kann fallen, aber man muss immer wieder aufstehen. Und man muss das Handwerk beherrschen, eine vernünftige Ausbildung haben, kreativ sein und Ideen haben.
Warum ist das Existenzgründertum in Deutschland nicht richtig ausgebildet?
Ich glaube, dass in Deutschland die Wertschätzung gegenüber Gründern nicht so ausgeprägt ist wie zum Beispiel in den USA. Da finden es alle toll, wenn sich jemand selbstständig macht. Hier wird der Existenzgründer schon häufig von der Familie gebremst. Geh lieber in einen Konzern oder zur Behörde, heißt es oft. Dort bekommst Du eine gute Ausbildung, einen sicheren Job. In Deutschland sind die Suche nach Sicherheit und die Angst zu scheitern viel größer als in den Vereinigten Staaten von Amerika.
Es gibt in Deutschland viel Geld, aber die Bereitschaft, es – wie in den USA – für neue Ideen zu investieren, ist nicht besonders groß. Wie kann man die Menschen, die das viele Geld besitzen, dazu bringen, mehr in Start-ups zu investieren?
Es ist richtig, in Amerika gibt es viel mehr Fonds, um Risikokapital bereitzustellen. Das ist in Deutschland bei Weitem nicht so ausgeprägt. Dennoch hat sich dies im Laufe der Jahre deutlich verbessert. Auch hier gibt es inzwischen zahlreiche Fonds und Mittel, die für Onlineprojekte bereitgestellt werden. Die Otto Group spielt da eine wichtige Rolle. Im Hardware-Bereich benötigen die Start-ups allerdings ein ganz anderes Startkapital. Im technischen Bereich gibt es noch nicht genügend Geldmittel. Da sind wir in Deutschland außerordentlich schwach.
Amazon ist die Nummer 1 im Onlinehandel. Auch in Deutschland. Die Otto Group steht an zweiter Stelle. Sie haben sich vor einigen Jahren dagegen entschieden, bei Amazon einzusteigen. War das nicht ein unternehmerischer Fehler?
Im Nachhinein kann man natürlich sagen, dass es ein Fehler war. Man hätte damit viel Geld verdienen können. Aus damaliger Sicht war es aber insofern kein Fehler, denn das ursprüngliche Konzept von Amazon, Bücher, CDs und Videos anzubieten und kostenfrei zuzustellen, hat bis heute kein Geld verdient. Als sie aber eine hohe Kundenzahl hatten, schafften sie eine Plattform, bei der sie die Sortimente verbreiterten und Drittanbieter mit aufnahmen – Einzelhändler, Markenproduzenten. Von denen bekommt Amazon eine Umsatzprovision. Später sind sie ins Cloud Business eingestiegen, weil sie für ihre riesigen Datenmengen sehr große Speicherkapazitäten und Rechner brauchten, und haben das vermarktet. Damit verdient das Unternehmen jetzt richtig Geld. Das war damals nicht vorhersehbar. Man muss auch sagen, dass Jeff Bezos, bei aller Tüchtigkeit, ein irres Glück gehabt hat. Er hat Finanziers gefunden, die jahrelang Geld zur Verfügung gestellt haben, als Milliarden verbrannt wurden.
Sie haben einmal gesagt: Wirtschaft muss für die Menschen da sein und nicht umgekehrt. Die Philosophie der Otto Group basiert auf ökologischem und sozial verantwortlichem Wirtschaften. Wie haben Sie es geschafft, diese Philosophie ins Unternehmen zu implementieren und umzusetzen?
Wir haben damit bereits in den späten 70er Jahren begonnen. Ein Bericht des Club of Rome, „Grenzen des Wachstums“, hatte mich damals nachdenklich gestimmt. Mir ging es darum, ein Bewusstsein für Nachhaltigkeit zu schaffen und danach zu handeln. Das begann mit einzelnen Projekten im Unternehmen. 1986 habe ich nachhaltiges Wirtschaften und Umweltverträglichkeit zum weiteren Unternehmensziel erklärt und ein Umweltmanagementsystem aufgebaut. In jedem Bereich gab es einen Ansprechpartner für das Thema Umwelt. Einige waren begeistert, weil sie es auch wichtig fanden, andere sahen es eher neutral und manche waren kritisch, dass sie neben Umsatz und Ergebnissen auch noch auf die Umwelt achten sollten. Das ist ein Prozess, der über viele Jahre gestützt werden muss, bis sich eine Eigendynamik entwickelt. Ich würde sagen, heute gehört es bei uns in der Unternehmensgruppe zur DNA.
Wie lässt sich die Firmenphilosophie mit dem Wettbewerb vereinbaren?
In der zweiten Hälfte der 90er Jahre haben wir damit begonnen, unseren Lieferanten Sozialstandards vorzugeben, die regelmäßig kontrolliert wurden. Ende der 90er habe ich alle Vorstandsvorsitzenden der deutschen Groß- und Einzelhandelsunternehmen eingeladen und ihnen gezeigt, wie wir unsere Sozialstandards umsetzen. Ich sagte zu ihnen: Wir können überall konkurrieren, nur nicht zu Lasten des Umwelt- und Sozialstandards. Wollen wir nicht gemeinsame Standards entwickeln? Die meisten waren sofort dabei. Inzwischen setzen über 2000 Einzelhändler und Markenproduzenten aus Europa diesen Sozialstandard im Rahmen der sogenannten BSCI (Business Social Compliance Initiative) ein. Damit erzielen wir eine große Durchschlagskraft.
Das Thema Flüchtlinge bewegt das Land. Sie sind als Flüchtlingskind nach Deutschland gekommen. Wie empfinden Sie die derzeitige Diskussion um Ausländer in Deutschland?
Ich finde es sehr bedauerlich, dass nicht sachlich darüber gesprochen wird. Das Problem ist, dass wir 2015 von der großen Zahl der Flüchtlinge überrollt wurden. Selbstverständlich müssen wir Menschen aufnehmen, die um Leib und Leben fürchten und aus Kriegsgebieten fliehen. Diejenigen, die kein Bleiberecht haben, müssen wir konsequent zurückschicken. Langfristig müssen wir aber die Fluchtursachen bekämpfen, denn nur so werden wir das Problem auf Dauer lösen können. Darüber hinaus müssen wir über ein konkretes Einwanderungsgesetz regeln, welche Migranten wir suchen, brauchen und wollen und damit eine gezielte Zuwanderung in unsere Systeme ermöglichen, um den demografischen Wandel in unserem Land in den Griff zu bekommen.
Sie haben das Flüchtlingsprojekt „IPSO“ mitfinanziert. Dort erhalten seelisch belastete Flüchtlinge psychologische Unterstützung, um schneller in die Gesellschaft integriert zu werden. Wie kann Integration noch verbessert werden?
IPSO halte ich für eine wichtige Maßnahme. Viele Flüchtlinge kommen durch Kriegshandlungen stark traumatisiert in unser Land. Hier werden sie zum zweiten Mal traumatisiert, denn alles, was sie im Leben gelernt haben, an Verhaltensweisen, an Umgangsweisen, stimmt plötzlich nicht mehr. Es gibt überdurchschnittlich viele Selbstmorde in den Flüchtlingsheimen und eine hohe Aggressivität. Beides entsteht aus Hilflosigkeit. Durch die psychosozialen Gespräche, die mit den Menschen bei IPSO geführt werden, wirken wir diesen Verhaltensweisen erfolgreich entgegen. Die Menschen sind besser integrierbar, weil sie wieder Mut zum Leben haben. Das ist ein Weg. Die Wirtschaft hat ebenfalls eine große Aufgabe, denn gerade über die berufliche Einbindung ist die Integration mit am besten möglich.
Immer mehr Menschen gehen auf die Straße, grölen rechte Parolen und greifen sogar anders aussehende Menschen an. Glauben Sie, dass unsere Demokratie den Zustrom von Flüchtenden aushält und ein gemeinsames, friedliches Miteinander unterschiedlicher Kulturen in Deutschland möglich ist?
Ja, davon bin ich überzeugt. Aber wir müssen uns immer wieder in Diskussionsrunden einbringen und klarmachen, dass es keinen Hass gegenüber Fremden und Ausländern geben darf. Das ist ein No-Go. Die Menschenrechte müssen respektiert werden. Es hat in der Geschichte der Menschheit immer Migrationsbewegungen gegeben, die sich in der Regel positiv ausgewirkt haben. Ich denke, dass wir in einer wehrhaften Demokratie durchaus mit radikalen Äußerungen am rechten oder linken Flügel klarkommen können und müssen. Aber wir müssen uns damit aktiv auseinandersetzen.